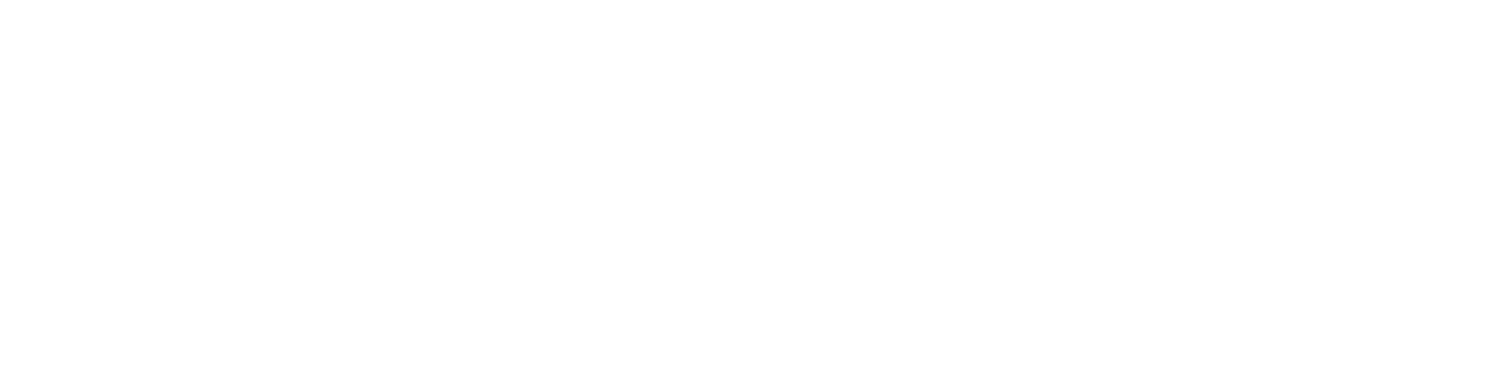Laubnachbarn
Mit versunkener Hingabe, leisem Lächeln auf dem Gesicht und dem Wissen, wirklich Sinnvolles zu tun: So reche ich Laub. Und lasse mir genüsslich Zeit dabei, denn bis das letzte Blatt an den vielen Zweigen über mir gefallen ist, dauert es. Mehrere Wochen und ausgewachsene Laubhaufen lang. Dankbar gebe ich mich dem Zauber all dieser laubrechenden Momente hin – die frischkühle Luft im geröteten Gesicht, das einlullende Schrr-schrr-schrr in den Ohren, der waldpilzige Herbstduft in der Nase, das wohltuende Alleinsein in stillen Gedanken … Habe ich schon erwähnt, dass ich das Laubrechen liebe?
In meiner ehemaligen Nachbarschaft beschäftigte man sich mindestens so leidenschaftlich mit Laub, wenn auch auf etwas andere Weise. Eines lange vergangenen Oktobers schob ich neugierig den Wohnzimmervorhang beiseite. Draussen regnete es Bindfäden, das seltsame Dröhnen konnte also unmöglich von ... Doch. Es kam. Von einem Laubsauger. Bewaffnet mit Regentracht, grimmigem Gesicht und besagtem Gerät versuchte der Vater der Nachbarin Blätter vom gepflasterten Weg neben dem Zierbeet zu saugen. Bis ihm einfiel, das Übel an der Wurzel anzupacken, und zwar an meiner Hecke. «Was tun Sie da?», versuchte ich den Lärm zu übertönen, nachdem ich empört zum Ort des Geschehens geeilt war. «Das sind doch Hainbuchen! Da bleibt das Laub bis zum Februar hängen, das müssen Sie doch nicht …» Aber doch, versicherte er nachdrücklich, das müsse er. Irgendwann falle das. Und das gehe nicht. Mit ausladender Gestik schwärmte ich, wie dankbar der Boden sei für diesen tollen Gratismulch und dass … Ich brauchte den Satz nicht zu beenden – sein irritierter Blick sprach Bände.
Wenige Tage später, ich war am Abwaschen, sah ich die Krone meiner Traubenkirsche so wackeln, als riebe sich ein Wildschwein daran. Wenn nicht zwei. Vorsichtig traute ich mich raus und äugte den Hang runter. Da war kein Schwein, aber ein Vater. Schon wieder. Wenn auch der anderen Nachbarin. «Was bitte tun Sie da?» Er hörte kurz auf mit Schütteln und lächelte in Erwartung eines jubelnden Dankeschöns zu mir rauf: «Na, den Dreck wegmachen, wenn ich eh schon dabei bin!» Ich seufzte. Diesen naturnahen Hang hatte ich doch genau so angelegt: dass das Laub nicht nur fallen darf, sondern soll. Und mir so das Jäten erspart. Ich versuchte gar nicht erst, es dem Manne zu erklären.
Dass man der Überzeugung sein kann, man müsse dem Laubhaftigen persönlich zeigen, was eine Harke ist, gab mir zu denken und bewog mich, mit anderem Beispiel voranzugehen. Nicht müde wurde ich, dies Geschenk des Himmels zu nutzen und lobpreisen. Als teppichweicher Bodenbelag auf Sitz- oder Kompostplätzen, als Winterschutz für nicht ganz frostharte Gemüse, frisch oder angerottet als Mulch, als Anzuchterde in Form reifen Komposts, als Sichtschutz unter hochbeinigen Hecken oder einfach so auf einem Haufen für Kreuch- und Fleuchendes.
Es war Herbst und vor einem Jahr, als ich mein Lieblingsbeet entlangkroch und minutiös jedes gefallene Haselblatt von meinen Alpenveilchen klaubte. Ja, es war kein Zeichen besonderer Intelligenz, ausgerechnet hier, direkt zu Füssen eines ausladenden Laubnachbarn, herbst- und winterprunkende Pflanzen zu setzen. Aber Ästhetik ist manchmal wichtiger als Intelligenz. Besonders dann, wenn sie sich direkt neben dem Hauseingang befindet. Mit nachsichtigem Lächeln auf mich runterblickend ging ein Handwerker an mir vorbei und meinte: «Die solltest du liegen lassen, das Zeug ist echt gut für den Boden, weisst du.»
Mit unverblümt-schelmischem Vergnügen schreibt die leidenschaftlich gärtnernde Nicole Häfliger über das, was gemeinhin verschämt unter den sattgrünen Rollrasen gekehrt wird: über Misserfolge, Missgeschicke und Misstritte – mit Vorliebe die eigenen.