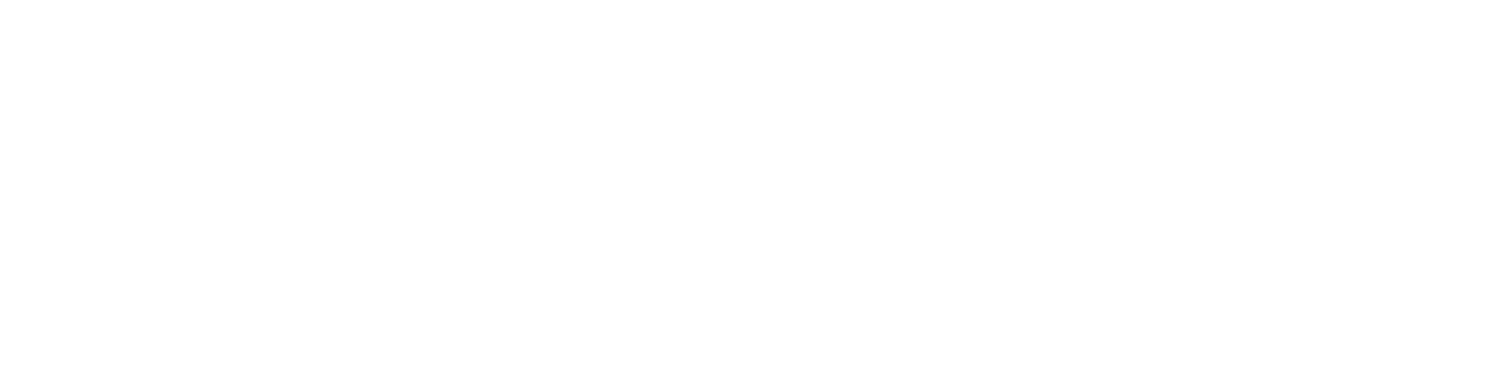Eine Beziehung mit Wurzeln
Biophobie? Biophilie!
Ohne Wimpernzucken stecken Gärtnerinnen ihre Hände in die Erde. Pflanzenfreunde verbringen Stunden in Natur und Garten, um über die Wunder von Flora und Fauna zu staunen. Etwas anderes ist für sie kaum vorstellbar. Denn: Ist die Liebe zur Natur nicht das «Natürliche»? Etwas, was in uns allen genetisch angelegt ist? Warum dies nicht so eindeutig ist, erzählt die britische Psychiaterin und Buchautorin Sue Stuart-Smith im Gespräch.
Text: Carmen Hocker, Bilder: Martin Timm
Die Natur hat eine heilende Wirkung auf uns Menschen. Für Naturliebende mag diese Aussage selbstverständlich klingen. Auch Sue Stuart-Smith, britische Psychiaterin und Ehefrau des Gartenarchitekten Tom Stuart-Smith, kam zu dieser Erkenntnis. Ein ganzes Buch hat sie darüber geschrieben, wie Menschen über eine neu gewonnene Verbindung zur Natur wieder zu sich selbst finden: «The Well Gardened Mind – Rediscovering Nature in the Modern World». Damit stiess sie auf unglaubliche Resonanz. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde ihr Buch in 15 Sprachen übersetzt.
«In unserer DNA ist aber nicht nur Biophilie – die Liebe zur Natur –, sondern auch das Gegenteil verankert: Biophobie, die Angst vor allem Lebendigen, auch vor bestimmten Tieren wie Spinnen zum Beispiel», gibt die Autorin zu bedenken. Um dies zu veranschaulichen, geht sie zu unseren Ursprüngen zurück, als der Mensch noch Jäger und Sammler war und sich dadurch der Natur zugehörig fühlte. Da die Umwelt auch Gefahren bereithielt, war es zum Überleben notwendig, diese richtig einschätzen zu können. Blindes Vertrauen wäre fatal gewesen. Noch heute ist diese überlebensnotwendige Furcht in uns, wenn auch eher in Form eines bewundernden Staunens, wenn beispielsweise ein heftiges Gewitter heranrollt, ein Vulkan ausbricht oder Wasserfälle in die Tiefe stürzen.
„Über Naturgewalten zu staunen ist ein Gefühl, das nah an der Furcht ist.“
Schutz von Bedrohung unterscheiden
Alles, was wir nicht kennen, ist zunächst einmal beängstigend. So hat ein Kleinkind eine natürliche Furcht vor Fremden. Betritt eine unbekannte Person den Raum, hält es sich hinter den Eltern versteckt. Erst, wenn es diesen Menschen näher kennenlernt und sein Wohlwollen spürt, kann es Vertrauen fassen und sich ihm gegenüber öffnen. «Wir lernen, wer uns beschützt, was förderlich für unser Leben ist und was nicht», erklärt Stuart-Smith die natürliche Entwicklung eines Kindes. Auch für unsere Beziehung zur Natur sei es wichtig, sich ihr langsam anzunähern und möglichst früh mit ihr in Kontakt zu kommen. Im urbanen Raum haben viele Kinder und Jugendliche nicht das Privileg, in einem Haus mit Garten gross zu werden. Stuart-Smith engagiert sich deshalb ehrenamtlich und arbeitet unter anderem mit einer örtlichen Jugendhilfsorganisation zusammen. Als kürzlich wieder eine Schulklasse in ihrem Garten zu Besuch war, «konnte man spüren, wie glücklich die Kinder waren, draussen zu sein. Und sie liebten es, Schmetterlinge zu beobachten». Schwieriger sei es jedoch gewesen, ihnen die Angst vor dem «Dreck» zu nehmen. Nicht wenige hatten Mühe, Erde mit den Händen zu berühren: «Erde wird mit Strassendreck gleichgesetzt. Dabei ist der Boden der Ort, wo alles Leben beginnt. Erde ist ein lebendiger Organismus, den wir nähren und kultivieren müssen.» Diese Zusammenhänge zu erklären, ist für sie wichtiger Bestandteil eines solchen Schulprojekts. Die Angst vor schmutzigen Kleidern könne man dagegen ganz einfach aus der Welt schaffen: indem man Schürzen zur Verfügung stellt. «Womöglich ist es gar nicht so sehr die Angst vor dem Dreck, die manche Kinder abhält, im Garten aktiv zu werden, sondern viel mehr die Angst vor einer möglichen Schelte der Mutter», überlegt Stuart-Smith laut.
Wenn Pflanzen übersehen werden
«In Grossbritannien begann die Entfremdung von der Natur mit der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts. Damit ging ein Wechsel der Denkweise einher», ist Stuart-Smith überzeugt. Seit dieser Zeit werde die Natur als etwas Selbstverständliches betrachtet, als eine Ressource, die man nutzen und ausbeuten kann. Und nicht mehr als etwas, zu dem wir eine tiefe Verbindung haben. In jüngerer Zeit kommt noch die technologische Revolution hinzu, die Menschen weiter von der Natur entfernt. Die Angst vor der Natur, dem «Dreck», ist die logische Konsequenz. Doch diese Biophobie ist für Stuart-Smith deutlich weniger schlimm als die «Pflanzenblindheit». Damit bezeichneten die amerikanischen Botaniker:innen Elisabeth Schussler und James Wandersee schon 1998 ein Phänomen, das sie im Rahmen ihrer Forschung beobachtet hatten: Da mehr und mehr Menschen die Pflanzenwelt gar nicht mehr wahrnehmen, erscheint sie irrelevant. Ein Grund dafür ist, dass Pflanzen sich nicht bewegen und damit nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Stuart-Smith betont deshalb, wie wichtig es sei, schon früh sinnliche Erfahrungen in der Natur machen zu können und nimmt dabei Bezug auf ihren Welpen, der während des Interviews im Garten herumspringt: «Wie Rocket hier, der neugierig ist, die Welt zu erkunden und zu erfahren.»
Gartenarbeit – wohltuend verbindend
Bei ihrer Arbeit als Psychiaterin begegnet Stuart-Smith immer wieder Menschen, die keine Vorstellung davon haben, welche Rolle das Gärtnern bei ihrer Genesung spielen könnte. Nur aus Verzweiflung, als letzten Ausweg, lassen sie sich darauf ein. Dabei gibt es zahlreiche Gründe, die für Gartentherapie sprechen. «Rituale bringen Ordnung in unsichere Situationen», erklärt sie einen Vorzug des Gärtnerns. Im Einklang mit den Jahreszeiten zu arbeiten, hat etwas Stabilisierendes. Wenn wir im Frühjahr das Säen vergessen, können wir im Sommer nichts ernten oder wenn wir den richtigen Schnittzeitpunkt verpassen, tragen die Obstbäume weniger:
„Ein Garten ist für uns Menschen das beste Gegenmittel zum Prokrastinieren.“
Arbeiten nicht auf zuschieben und einem Rhythmus zu folgen, gibt uns Halt und Struktur. Hinzu kommt die soziale Komponente. Ein Garten ist ein sicherer Raum ohne Bedrohungen, in dem man ruhig nebeneinander arbeiten oder auch plaudern kann – ohne Leistungsdruck oder Erwartungen von aussen. Wie in der Natur selbst ist Kooperation wichtiger als Wettbewerb. Im Garten tauscht man nicht nur Erfahrungen und Tipps aus, man teilt auch seine Ernte. Abgesehen von Erfolgsgeschichten aus Therapiegärten berichtet Stuart-Smith in ihrem Buch auch aus urbanen Gemeinschaftsgärten – und aus Gefängnisgärten: «Einfach ausgedrückt verhalten sich Menschen inmitten von Pflanzen besser», erklärt sie. «Und die Arbeit mit der Erde fördert eine authentische Verbindung zwischen Menschen», führt sie weiter aus. Posen und Vorurteile spielen im Garten keine Rolle. Oder wie es ein Häftling im Gefängnisgarten von Rikers Island (USA) ausdrückte: «Niemand will hier die Blumen oder andere Menschen einschüchtern.»
Man muss nicht Pantheist sein, um in der Natur etwas Göttliches, Spirituelles zu sehen. Unabhängig von Glauben und Weltanschaung empfinden sich viele Menschen im Garten als Teil von etwas Grösserem. So auch Stuart-Smith:
„Im Garten fühle ich mich als eine von vielen Bewohner:innen. Wenn man Pflanzen hegt und pflegt, entsteht ein Gefühl der Vertraut und Verbundenheit.“
Sue Stuart-Smith
ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Vor ihrem Medizinstudium studierte sie Englische Literatur in Cambridge. Mit ihrem Mann, dem Gartenarchitekten Tom Stuart-Smith, hat sie den Barn Garden in Hertfordshire (GB) geschaffen.
„Die Kunst des Haiku ermuntert, Augenhöhe mit der eigenen Unwichtigkeit zu ertragen. Sie schult Wachsamkeit, Wahrnehmung und Wertschätzung vor dem Übersehbaren.“
Martin Timm
«Haiku. Verse wie Fotos. Zeilen zwischen zwei Vorhängen. Miniaturtheater für einen Plot, so kurz und knapp wie die allgeliebte 125stel. Mit leisem Fluidum dem Zen enthüpft, und man muss noch nicht mal in der Szene sein, um sich in sie zu verlieben.
Ihr Zauber kommt aus dem Nu. Sie entschlüpfen planlos, es wird nicht lange herumgefeilt – und doch gibt es strenge Regeln. Aber wer es kann, schafft es aus dem Stegreif. Ohne nachzudenken schwimmt man auch, fährt mit dem Rad oder balanciert tagtäglich auf zwei Füssen, die ja im Grunde relativ klein sind: Haiku, eine tolle Entdeckung.»