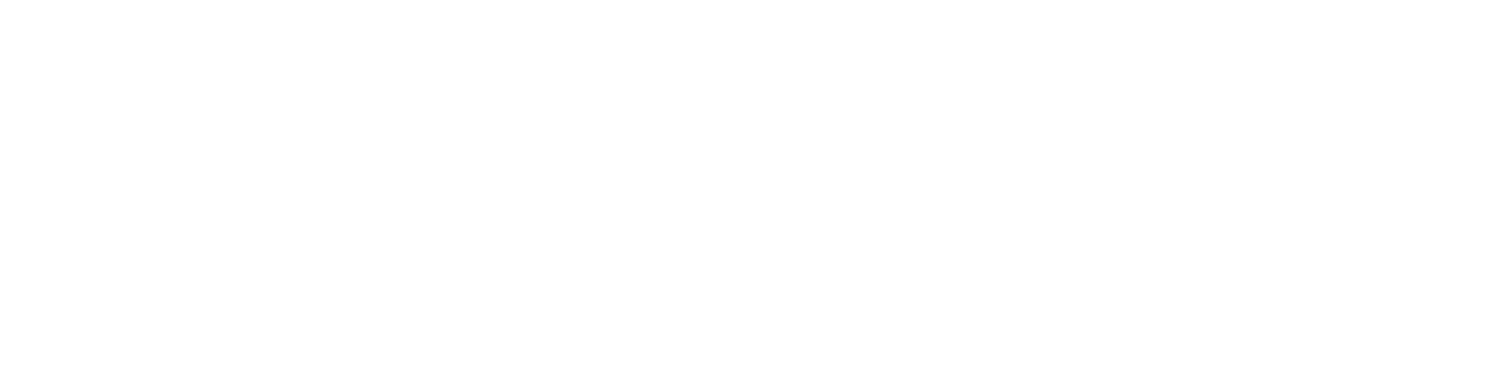Lebensbegleiter Baum
Von der Wiege bis zur Bahre – Bäume begleiten uns buchstäblich durch unser ganzes Leben.
Texte: Nicole Häfliger
Fruchtende Geburtsbäume
Die beliebte bäuerliche Tradition, zur Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen (einen Apfelbaum für Jungen, einen Birnbaum für Mädchen), wurde mancherorts von einer neuen Tradition namens Geburtsbaum abgelöst. Dabei wird ein auf einer Stange befestigtes, geschmücktes Tännchen in den Garten gestellt. Nicht anders verfährt man bei der «Geburt» eines Hauses: Zum Richtfest wird das Tännchen auf den Dachfirst gestellt – eine Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Wohl ähnlich alt, aber gänzlich veraltet ist der volksmundige Spruch:
Drei Dinge muss ein Mann in seinem Leben tun: ein Haus bauen, einen Sohn zeugen und einen Baum pflanzen.
Fälschlicherweise wird er gerne Luther in die Schuhe geschoben, die offensichtlich gross gewesen sein mussten, denn für einen zweiten war auch noch Platz:
Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen.
Von Luther ist auch dieser Satz nicht, auch wenn das bis heute kolportiert wird. Wahrscheinlich stammt er aus den 1930er-Jahren, ein erster schriftlicher Nachweis findet sich 1944. Ein Gutes hat die In-die-Schuhe-Schieberei doch. Dank des fiktiven Lutherspruchs wurden schon zig Apfelbaum-Pflanzaktionen durchgeführt, womit er gewissermassen zu einem echten Geburtshelfer geworden ist.
Hölzerne Buchstaben
Mit Bäumen hat auch das Schreiben zu tun: Die Annahme, das Wort «Buchstabe» bedeute «Stab aus Buchenholz», ist nicht ganz richtig – ganz falsch aber auch nicht. Wortgeschichtlich geht es auf das gotische bok (= gesticktes Kissen, Buch) und stabi (= Stab, Element) zurück. «Buchstabe» wurde ab dem 8. Jahrhundert für lateinische Buchstaben – im Gegensatz zu Runen – benutzt. Wie auch heute unterschieden sich Buch und Buche durch nur einen Buchstaben, jedenfalls im Plural: Bücher hiessen boks, Buchen hiessen boko. Ein möglicher Grund: Die früheren Schreibtafeln wurden meist aus Buchenholz gefertigt; ähnlich wie die zusammengebundenen Buchdeckel ab dem Mittelalter.
Nicht aus Buche werden hingegen Bleistifte gemacht. Stabil und flexibel, schnellwachsend und gut spitzbar soll das Holz sein, und das bieten Zeder, Kiefer, Ahorn und Linde. Schreibgeräte mit einem Kern aus Blei kannten schon die alten Ägypter. Graphit hingegen wurde erst später entdeckt – 1565 wird der Stift in seiner heutigen Form zum ersten Mal erwähnt … vom Schweizer Konrad Gessner. Das Blei im Namen ist übrigens nicht den Ägyptern geschuldet, sondern geht auf die damals irrige Annahme zurück, Graphit sei ein Bleierz. Man kann also beim Nachdenken ganz unbesorgt weiter auf dem Bleistift herumkauen.
Mondbeschienenes Heim
Der Tisch, an dem wir essen, das Parkett unter unseren Füssen und das Dach über dem Kopf – das Material Holz ist seit jeher beliebt, Holzhäuser sind gar im Trend. Dabei greift man gerne tiefer in die Tasche und gönnt sich Mondholz. Zu bestimmten Mondphasen geschlagen soll dieses Holz ganz besondere Eigenschaften aufweisen – haltbarer, reissfester, weniger von Schwund betroffen und resistenter gegen Pilzbefall, Insekten und Feuer sei es. Dies wissenschaftlich zu überprüfen, hat sich der Holzwissenschafter und Forstingenieur Ernst Zürcher zur Aufgabe gemacht. Seit den 1990er-Jahren forscht er zum Thema und konnte 2010 in einer Studie mit drei Schweizer Kollegen tatsächlich bestätigen, dass die alt überlieferten Mondholz-Praktiken der Forstleute ein wahres Körnchen haben könnten, zumindest was das Trocknungsverhalten des Holzes betrifft. Ob wahr oder nicht, eines ist unbestritten: Die Produktion von Qualitäts-Mondholz hängt nicht allein vom Mond ab, sondern auch vom Wissen, welcher Baum zu wählen ist, wie man ihn schlägt, das Holz trocknet, lagert und weiterverarbeitet. Und das ist – weit entfernt von der konventionellen, industriellen Massenerzeugung – wahre Handwerkskunst.
Letzte Stätten
Am Ende schliesst er sich wieder, der Kreis. Zu früheren Zeiten war es gang und gäbe, die Plazenta in Gefässen zu bestatten (was man übrigens erst seit 1984 dank eines Hobbyhistorikers weiss). Dies aus dem Glauben heraus, ihr wohne ein Wesen inne, das mit dem Kind verbunden sei. Erweise man dem Wesen nicht die letzte Ehre, räche es sich am Kind. Diese Tradition wiederzubeleben bot sich an, denn mit der Plazenta liess sich gleich der Baum düngen, den man zu Ehren des Kindes pflanzte – auf dass das Kind und der Baum gleichermassen gedeihen konnten.
Ein ähnlicher Gedanke liegt der Idee zugrunde, die Asche eines Menschen im Wurzelbereich eines Baumes zu bestatten, wie das in Friedwäldern geschieht. Auch hier nimmt der Baum die Nährstoffe der Asche auf – ein Sinnbild für das Fortbestehen des Lebens.
Der Kreis mag sich schliessen, zu einem Ende kommt er nie, erst recht nicht der Lebenskreis eines Baumes. → Man blättere diese – wie alle anderen auch aus Holz hergestellte – Seite um, bzw. kaufe das Einzelheft 7/8/2023, in dem der Lebenskreis einer Eiche erschienen ist.