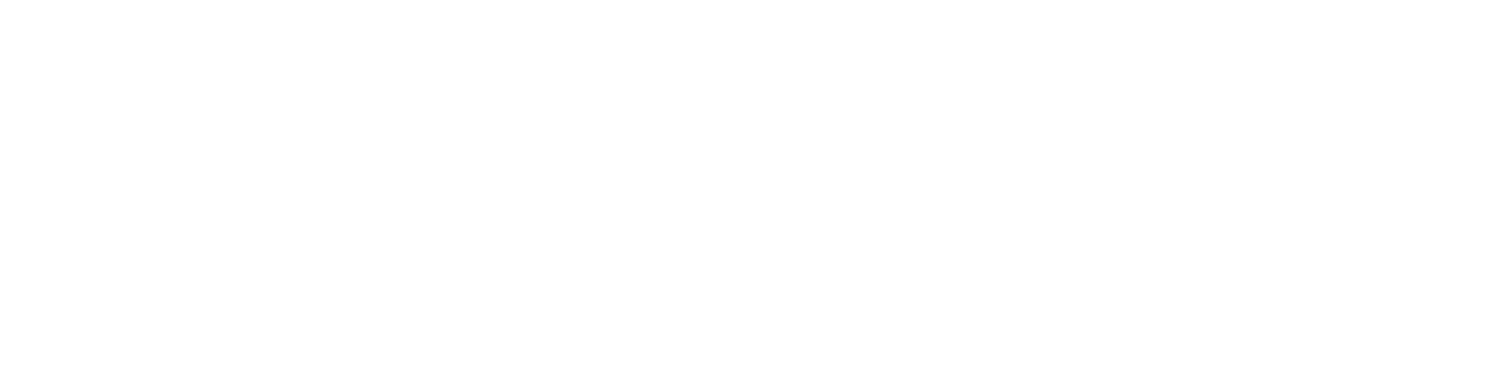Zwischen Schockstarre und Wertewandel
Sauberes Quellwasser und blühende Ackerbegleitflora sind Sinnbilder für eine intakte Umwelt. Dass deren langfristige Qualität von einem schonungsvollen Umgang abhängt, war Wissenschaftlern und Biolandbaupionieren schon vor vielen Jahrzehnten bewusst.
Im Sommer 2021 stimmen wir über zwei Initiativen ab, die sich für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide einsetzen. Der entfachte Diskurs erinnert an die Gründung des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) vor über vierzig Jahren. Als Wissenschaftler damals die konventionelle Düngungslehre hinterfragten, mussten sie sich so manche Polemik gefallen lassen. Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftsinteressen, Konsumgewohnheiten und der Notwendigkeit, die Bodenfruchtbarkeit und -gesundheit langfristig zu sichern, gibt es auch heute keine simplen Antworten – aber Hoffnungsschimmer.
Ein Blick zurück ins Jahr 1974. Am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in Oberwil hat sich eine illustre Runde zusammengefunden: der ETH-Pflanzenphysiologe Philippe Matile, der ETH-Agraringenieur Jean-Marc Besson, der Biolandbaupionier Hardy Vogtmann, der Landwirt Fritz Baumgartner und Nationalrat Heinrich Schalcher. Sie stehen kurz davor, einen Langzeitfeldversuch zu lancieren, um der Frage nachzugehen «Ist Biolandbau machbar – oder nehmen die Erträge – unter dem natürlichen Unkraut- und Schädlingsdruck – tatsächlich ab, wie Skeptiker mutmassen?»
Biologisch versus konventionell
Gut vierzig Jahre später gilt der sogenannte DOK-Versuch der FiBL-Wissenschaftler als weltweit bedeutendster Langzeitfeldversuch zum Vergleich von biologischen und konventionellen Anbausystemen. Fazit ist, dass die biologisch bewirtschafteten Böden noch immer produktiv sind und die Erträge über alle Kulturen hinweg auf hohem Niveau stabil bleiben.
Im Schnitt liegen sie um nur 20 % tiefer als im konventionellen Anbau, bei 50 % weniger Aufwand an Energie und Düngemitteln: «Im Vergleich zum konventionellen System setzt das biologische 86 % weniger Pflanzenschutzmittel (Aktivsubstanz) ein, das bio-dynamische 98 % weniger», erklärt Agronom und Biologe Dr. Paul Mäder, der seit 1987 am FiBL arbeitet und das Departement für Bodenwissenschaften leitet.
Langfristig betrachtet hat der Boden aber nicht nur die Aufgabe ertragreich zu sein. Er erbringt auch sogenannte Ökosystemdienstleistungen wie sauberes Trinkwasser, Erosionsschutz und Biodiversität: «Oberirdische Diversität bedeutet auch unterirdische – und umgekehrt. » So ist die Oberflächenstruktur beim Bioverfahren rauer, krümeliger, es gibt mehr Regenwurmlosungen und der Boden hat eine höhere Kapazität, Wasser zu speichern.
Die poröse Struktur und das aktive Bodenleben tragen dazu bei, dass sowohl Starkregenereignisse als auch Hitzeperioden besser verkraftet werden. Anders bei konventionell bewirtschafteten Flächen. Bodenorganismen, die unter anderem für die Bildung der Aggregate, der Krümel, verantwortlich sind, reagieren empfindlich auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel.
Gibt es weniger Bodenorganismen, ist der Boden nicht so locker und durchlüftet. Hinzu kommt, dass die Mineralteilchen des Düngers verschlämmen, sodass die Oberfläche eher glatt ist. Bei Starkregen bleibt das Wasser an der Oberfläche stehen, oder fliesst oberflächlich ab, was zu Bodenabschwemmung führen kann. Bei Trockenheit bildet sich eine Kruste, die Tone schrumpfen und es entstehen Risse. Die Böden sind weniger gut vor Erosion geschützt.
Ein Bergkanton geht eigene Wege
Trotz des fundierten Wissens um die Vorteile des Biolandbaus betrug im Jahr 2018 – laut Angaben der Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen BioSuisse – der Marktanteil von Biolebensmitteln nur rund 11 %. Der Anteil der biologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen lag im Schnitt bei 15 %.
Obwohl die Tendenz steigend ist, überwiegt in der Schweiz die konventionelle Landwirtschaft bei Weitem. Eine Ausnahme bildet der Kanton Graubünden, dessen Biofläche 65 % beträgt. Dass der Bergkanton die Weichen schon vor Jahrzehnten anders gestellt hat, führt der promovierte Agrarökonom Gianluca Giuliani unter anderem auf das Engagement der Mitarbeiter der bündnerischen landwirtschaftlichen Beratung zurück: «Schon vor zwanzig, dreissig Jahren gab es dort Menschen, die sich die Frage stellten, wie sich die Region nachhaltig entwickeln könnte», erklärt der Mitgründer des Agrar- und Regionalökonomischen Beratungsbüros Flury & Giuliani.
Ein Impuls sei die steigende Nachfrage nach Bioprodukten von Zürcher Reformhäusern gewesen. Und Direktzahlungen an jene Landwirte, die ihre Weideflächen weniger intensiv bewirtschafteten, indem sie zum Beispiel ihre Wiesen zu einem späteren Zeitpunkt mähten, damit die Wildblumen zur Blüte gelangen konnten, um sich zu versamen.
Mosaiksteine fügen sich zusammen



Wie so oft ist es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das zum Erfolg führt. Beispielhaft ist das Val Poschiavo im äussersten Südosten Graubündens. Die rund 4300 Einwohner zählende Region steht kurz davor, die 100 %-Marke an Bioflächen zu erreichen.
Giuliani, Sohn eines Käsers und Landwirts aus Poschiavo, hat die Verbindung zu seiner Heimat trotz des Studiums und der Arbeit in Zürich immer gepflegt. So war es für ihn selbstverständlich, eine Gruppe engagierter Landwirte und Gemeindevertreter dabei zu unterstützen, die Region weiterzuentwickeln und die gesetzlichen Grundlagen zu nutzen: Basierend auf der staatlichen Strukturverbesserungsverordnung lancierten sie gemeinsam Projekte, um alle Bereiche der Wertschöpfungskette zu verbessern, von der Produktion bis zu einer gemeinsamen Logistik- und Vermarktungsplattform.
Tourismus didaktisch
Nicht alle waren von Anfang an begeistert. Solche Prozesse brauchen Zeit. Manche mussten erst die Erfolge der anderen sehen, um sich überzeugen zu lassen: «Das Interesse der Touristen an lokal und biologisch produzierten Lebensmitteln – meist Gäste aus dem urbanen Milieu – brachten die letzten Skeptiker zum Umdenken», erzählt Giuliani.
Doch selbst eine anfänglich monetäre Motivation kann zur Annäherung ans Thema führen: «Die heutige Generation Landwirte ist stolz darauf, fast verloren gegangenes Wissen anzuwenden. Einige Bauern betreiben im Tal zum Beispiel wieder Ackerbau mit angepassten alten Sorten von Wintergerste, -weizen und Buchweizen.»
Ganz so idyllisch wie es in den Köpfen mancher Städter erscheinen mag, ist jedoch auch die Welt im Val Poschiavo nicht. Dass die 100%-Marke noch nicht vollständig erreicht wurde, liegt nicht nur an ein paar eigenwilligen Hobbylandwirten. Einer der Letzten, der hadert, ist der Beerenproduzent Nicolò Paganini. Ein Teil seiner Flächen liegt auf den Terrassen, die zum UNESCO-Welterbe zählen und an der Strecke der rhätischen Bahn liegen. Zu gerne würde er rein biologisch wirtschaften.
Doch wie soll er mit der asiatischen Kirschessigfliege umgehen, die ihre Eier in intakte Beeren legt und diese damit zum Faulen bringt? Fallen allein reichen nicht aus und engmaschige Netze würden das Bild der Postkartenlandschaft stören. Nun versucht er, die Umstellung auf Bio Schritt für Schritt umzusetzen, allfällige Ernteausfälle werden aus dem Projekttopf kompensiert: «Die Welt ist komplexer als man sich das vorstellen mag. Viele Bauern suchen selbstständig nach Lösungen, aber es braucht Zeit», gibt Giuliani zu bedenken. Seine Erfahrung aus diesem Projekt ist, dass die praktizierenden Bauern grundsätzlich einen grossen Gestaltungswillen haben, sofern sie sich in einem dies fördernden Umfeld bewegen können, wie im Fall von Nicolò Paganini.
Sonderstellung oder Vorbild
Kann eine Region wie Val Poschiavo als Modell für die ganze Schweiz dienen? – eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Was die Erfolgsgeschichte von Val Poschiavo zeigt ist, dass am Anfang immer engagierte Menschen stehen, die mit ihrer Überzeugung und Energie buchstäblich Berge versetzen möchten.
Damit sie ihre Vision Wirklichkeit werden lassen können, benötigen sie entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen und Unterstützung von allen Seiten: angefangen bei den landwirtschaftlichen Akteuren, über den Handel bis hin zu den Konsumenten, die voraussichtlich im Juni 2021 die Möglichkeit haben, über zwei Initiativen abzustimmen: Die «Initiative für sauberes Trinkwasser» und die «Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide».
Eine Besonderheit in einem kleinen Land wie der Schweiz ist, dass die landwirtschaftlichen Flächen oft unmittelbar an Fliessgewässer grenzen, die von grosser ökologischer Bedeutung sind: «Sensible Organismen wie wirbellose Tiere werden schon durch geringe Konzentrationen geschädigt, die Lebensgemeinschaften in Ackerbaugebieten sind nachweislich verarmt und gesetzlich zulässige Grenzwerte werden vielerorts überschritten», berichtet Dr. Christian Stamm, stellvertretender Abteilungsleiter Umweltchemie an der EAWAG Dübendorf, an einem Vortrag der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur im Herbst 2020.
In Bezug auf das Grundwasser stellt er fest, dass die Belastung im Einflussgebiet landwirtschaftlicher Flächen ebenfalls erhöht ist. Ein wesentlicher Unterschied zu den Fliessgewässern ist, dass die Reaktionszeit bedeutend länger ist. Veränderungen im Grundwasser treten erst nach Jahren bis Jahrzehnten zutage.
1. Trinkwasserinitiative: Ansatz Direktzahlungen
Diese Initiative fordert, dass die Subventionen an die Landwirtschaft nur für Bewirtschaftungsweisen ausgerichtet werden, welche die Gesundheit und die Umwelt nicht gefährden und das Trinkwasser nicht verschmutzen.
Direktzahlungen wären an den bereits gesetzlich geforderten ökologischen Leistungsnachweis gebunden sowie an folgende zusätzliche Bedingungen: Erhalt der Biodiversität, eine pestizidfreie Produktion und ein Tierbestand, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann.
Landwirtschaftsbetriebe, die Antibiotika in der Tierhaltung prophylaktisch einsetzen oder deren Produktionssystem einen regelmässigen Einsatz von Antibiotika nötig macht, würden von Direktzahlungen ausgeschlossen werden. «Um Qualität, Ertrag und Einkommen nachhaltig zu sichern, würden Bäuerinnen und Bauern mit Bildung, Forschung und Investitionshilfen unterstützt werden. In Anbetracht der komplexen Sachlage beträgt die Übergangsfrist acht Jahre», führt Franziska Herren, Mitinitiantin der Initiative, aus. Unterstützt wird sie von 4aqua (www.4aqua.ch), einer Interessengemeinschaft, in der sich über 140 Wissenschaftler*innen und Fachleute zusammengeschlossen haben.
Die Kurzfassung des Initiativtextes hat im Vorfeld der Abstimmungen zu missverständlichen Vereinfachungen geführt. Eine Kontroverse ist zum Beispiel um das Thema Tierfutter entfacht. So sind auf der Website www.trinkwasserinitiative-nein.ch, die vom Schweizer Bauernverband (SBV) betrieben wird, Zitate mehrerer Landwirte zu lesen, in denen sie von der Unmöglichkeit sprechen, ihr Futter ausschliesslich selbst zu produzieren.
Das ist aber keine Bedingung der Initiative. Im Argumentarium heisst es, dass Betriebe weiterhin regional untereinander Futtermittel und Hofdünger austauschen bzw. gemeinsam nutzen sollen und können, auch in Form von Betriebsgemeinschaften.
2. Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide: Ansatz Verbot und Inklusion
Sie fordert das Verbot von synthetischen Pestiziden und umfasst neben der Landwirtschaft auch private und gewerbliche Anwendende sowie die öffentliche Hand. Um eine Gleichberechtigung der Schweizer Landwirtschaft zu erreichen, haben die Initianten auch Importprodukte wie Früchte, Gemüse und Getreide vollumfänglich eingeschlossen.
Bis heute ist beispielsweise der Import von Lebensmitteln mit Chlorothalonil-Rückständen noch erlaubt, während das Fungizid seit 1. Januar 2020 in der Schweiz aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung verboten wurde. Die Initiative sieht eine Übergangsfrist von zehn Jahren vor.
Um der Landwirtschaft eine schrittweise Umstellung zu ermöglichen und allen Beteiligten genügend Zeit zu geben, die notwendigen Massnahmen für einen Verzicht auf synthetische Pestizide zu ergreifen, sehen beide Initiativen eine Übergangsfrist vor.
Die politischen Akteure sind aufgerufen, das Landwirtschafts- und Ernährungssystem zu überarbeiten und die relevante Gesetzgebung anzupassen. Parallel dazu fordern die Initianten die Forschung dazu auf, eine Landwirtschaft zu entwickeln, die mehr Rücksicht auf die Biodiversität und die menschliche Gesundheit nimmt.
Unsere Lebensgrundlage bewahren
Vielleicht sollten wir die Natur als Vorbild nehmen, deren Zusammenhänge komplex und auf vielfältige Weise miteinander verbunden sind.
Auch wenn wir nicht alles erklären können, ist sicher, dass wir dabei sind, unsere Lebensgrundlage – Wasser, Boden und Luft – mehr und mehr zu zerstören. Welche Mengen an Pestiziden zu welchen Auswirkungen führen, ist im Grunde unerheblich. Es besteht Handlungsbedarf. Und es gibt Lösungsansätze.
Die FiBL-Wissenschaftler Adrian Müller und Christian Schader haben 2017 im Fachmagazin «Nature Communications» einen Artikel veröffentlicht, in dem sie aufzeigen, dass Biolandbau die Welt ernähren könnte, sofern man Foodwaste und Fleischkonsum reduzieren könnte.
Zwei Kernpunkte, die ohne gesellschaftlichen Wertewandel wohl nicht möglich sind. Letzterer betrifft deshalb jeden und jede von uns. Wollen wir weiterhin Fortschritt um jeden Preis? Konsum ohne Rücksicht auf die Folgen? Oder sind wir bereit, etwas zu ändern?
Überall auf der Welt schliessen sich Menschen zusammen, die etwas bewegen möchten und beziehen Stellung. So schreibt der Autor Stéph Donse im australischen Online-Gartenmagazin «The planthunter»: «Wir müssen auf individueller Ebene beginnen: mit unserer eigenen Beziehung und Liebe zur Natur (…) Wenn wir uns selbst als Hüter betrachten, dann ist die halbe Arbeit getan.»
Damit das Engagement jedes Einzelnen Früchte tragen kann, benötigen wir aber angepasste gesetzliche Rahmenbedingungen, wie sie beispielsweise in den Initiativen gefordert werden.
Text: Carmen Hocker
Stimmungs-
barometer
Als weiteren Impuls für die eigene Entscheidungsfindung hat der «Pflanzenfreund» drei Organisationen um Stellungnahme gebeten. Weiterführende Informationen finden Sie auf den jeweiligen Websites.
Kleinbauern-Vereinigung
«Wir unterstützen die Zielrichtung beider Initiativen, bevorzugen jedoch den Umsetzungsweg der Pestizidinitiative. Im Gegensatz zur Trinkwasserinitiative nimmt die Pestizidinitiative nicht nur die Landwirtschaft in die Pflicht, sondern alle bisherigen Pestizidanwender.
Neben den Bäuerinnen müssten somit auch die öffentliche Hand, der Gartenbau, die SBB sowie alle privaten Gartenbesitzerinnen auf synthetische Pestizide verzichten. Das Anwendungsverbot beschränkt sich zudem nicht nur auf die inländische Landwirtschaft, auch Importe wären davon betroffen. Heute dürfen beispielsweise Produkte mit Chlorothalonil-Rückständen importiert werden – obwohl dieses Mittel in der Schweiz auf den 1. Januar 2020 verboten wurde.
Die Schweizer Landwirtschaft kann auf Pestizide verzichten. Wer an der Umsetzbarkeit der Pestizidinitiative zweifelt, vergisst oftmals, dass diese nur längerfristig fordert, was Biobäuerinnen und Biobauern schon heute umsetzen.
Die Initiative sieht ausserdem eine Übergangsfrist von zehn Jahren vor. Wichtige Zeit also, um die Forschung auf die neuen Voraussetzungen auszurichten. Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft ist in der Forschung für den Biolandbau schon länger klar, dass der Pflanzenschutz mehrdimensional weiterentwickelt werden muss. Das betrifft beispielsweise auch die Pflanzenzüchtung, die mechanische Unkrautbekämpfung und die Förderung von Nützlingen.
Nur mit gesunden Böden kann unsere Ernährung auch für die Zukunft gesichert werden. Es braucht jetzt ein Umdenken in der Landwirtschaft und der gesamten Bevölkerung hin zu einer vielfältigen, ökologischen Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, Gärten und Grünanlagen.
Die Schäden, welche durch die Pestizidanwendung angerichtet werden, gefährden die Resilienz der Schweizer Landwirtschaft und unsere natürlichen Ressourcen. Und sie kommen die Allgemeinheit längerfristig teurer zu stehen.»
uniterre
«Unterschiedliche Lösungsansätze bestehen zwischen den beiden Initiativen, gleichwohl sie dasselbe Ziel verfolgen: Eine Landwirtschaft ohne synthetische Pestizide. Die «Initiative für sauberes Trinkwasser» beinhaltet aber kein Verbot, sondern sieht die Streichung der Direktzahlungen für nicht pestizidfreie Betriebe vor.
In Branchen wie dem Wein- oder Obstbau kann dies zu einer weiteren Intensivierung führen, um den Wegfall der Direktzahlungen zu kompensieren. Der gravierendste Punkt jedoch sind die Importe: Während im Inland eine «saubere» Schweizer Landwirtschaft gefordert wird, bleiben die Lebens- und Futtermittelimporte, die oft pestizidverschmutzt sind, unangetastet.
Bereits heute ist die hiesige Landwirtschaft durch den Grenzhandel finanziell stark unter Druck – denn die Produktion ist im Ausland viel billiger. Das einseitige Pestizidverbot würde diese Differenz verschärfen. Der Mehraufwand, z.B. bei den Arbeitskräften, wird in keinster Weise berücksichtigt, sondern an den Markt delegiert. Das ist ungenügend und deshalb lehnt Uniterre diese Initiative ab.
Die Initiative «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» dagegen behandelt die zentrale Frage der Importe und sieht vor, dass auch Produkte aus dem Ausland – für Lebens- und Futtermittel – frei von Pestiziden sind. Zugleich fordert sie ein Verbot für synthetische Pestizide nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Pflege von Landschaft, Grünflächen und öffentlichen Räumen.
Die Umsetzung dieser Initiative wäre für die Bäuerinnen und Bauern sehr anspruchsvoll, denn auch hier fehlen finanzielle Begleitmassnahmen, die den erheblichen Mehraufwand bei der Produktion abfedern könnten. Ferner müssten Lösungen, unter anderem mithilfe einer gezielten Forschung und selbstverständlich unter Ausschluss von Gentechnikverfahren, gefunden und umgesetzt werden. Uniterre unterstützt die Ziele dieser Initiative für eine ökologische Landwirtschaft und erhofft sich einen breiten Dialog mit der Gesellschaft über die Herausforderungen eines solchen Projektes.»
Schweizer Bauernverband
«Wir lehnen beide Initiativen ab. Die Trinkwasserinitiative erachten wir als reine Mogelpackung. Mit sauberem Wasser hat sie nichts zu tun. Ihr einziger Ansatzpunkt sind die Direktzahlungen. Direktzahlungen erhalten nur jene Bauernbetriebe, die den sogenannten ökologischen Leistungsnachweis einhalten.
Dieser umfasst über das Gesetz hinausgehende Anforderungen wie zum Beispiel, dass jeder Betrieb eine Mindestfläche für die Förderung der Biodiversität ausscheidet. Die Initiative will diese nun an weitere einschneidende Bedingungen knüpfen.
Ganz ohne Pflanzenschutzmittel ist eine Landwirtschaft, die vom Verkauf ihrer pflanzlichen Kulturen lebt, nicht möglich. Denn trotz Vorsorgemassnahmen können je nach Wetter Krankheiten oder Schädlinge die Ernten massiv reduzieren oder zu einem Totalausfall führen.
Um unseren Bedarf an Essen zu decken, müssten wir also mehr importieren. Da ausländische Produkte aber weniger nachhaltig produziert sind, ist der Effekt für die Umwelt gesamthaft negativ.
Für Betriebe mit anfälligen Spezialkulturen wie Obst, Reben oder Gemüse sind die Direktzahlungen nicht so wichtig. Sie würden ganz darauf verzichten. Damit müssten sie auch den ökologischen Leistungsnachweis nicht mehr einhalten.
Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» will den Einsatz von synthetischen Pestiziden verbieten. Es dürften auch nur noch Lebensmittel eingeführt werden, die ohne produziert worden sind. Die Schweizer Bevölkerung könnte nur noch Bioprodukte pflanzlicher Herkunft kaufen und ihre Ausgaben fürs Essen würden sich folglich stark erhöhen.
Die Landwirtschaft nimmt die von den Initiativen angesprochenen Themen ernst und anerkennt Handlungsbedarf. Die Antworten auf die Herausforderungen sind bereits in Umsetzung. Die Konsumentinnen und Konsumenten selbst haben es ebenfalls in der Hand, indem sie vermehrt besonders nachhaltig produzierte Lebensmittel kaufen und so deren Absatz ankurbeln.»